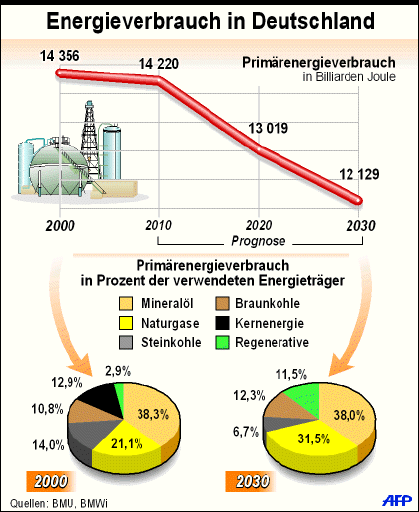Dossier: Die Hedge Fonds-Gesellschaften
Von Elmar Getto
Eigentlich ist die Bezeichnung Hedge-Fond-Gesellschaften irreführend, aber das macht in Deutschland nichts, denn hier heißen sie unwideruflich „Heuschrecken-Gesellschaften“, seit ‚Münte’ diesen zweifellos treffenden Vergleich einführte. Ein US-Analyst hat sie einmal AAC (Assets Assault Companies, in etwa: Wert-Raub-Gesellschaften) genannt, was der Wirklichkeit wohl am nächsten kommt. Andere Bezeichnungen, die ebenfalls nicht den Charakter treffen, sind: „Private Equity-Firmen“ und „Venture Capital Gesellschaften“.
Ein Hedge-Fond ist eigentlich eine Geldanlage, die hohe Gewinne bringen kann, aber auch äußerst risikoreich ist. Was diese Gesellschaften aber machen, hat kein größeres Risiko. Es ist vielmehr eine der lukrativsten und gleichzeitig risikoärmsten Investitionen, die es gibt. Das einzig Negative ist, daß es ein bißchen anrüchig ist, daß man sich als Heuschrecken beschimpfen lassen muß, aber wen juckts?
Das Prinzip, das sie alle eint, ist logisch und einfach: Jede halbwegs gut geführte Firma ab einer gewissen Größenordnung stellt einen Wert dar, der weit über dem jeweiligen Kaufpreis liegt und der beleihbar ist. Man kauft die Firma, beleiht die Werte bis auf den letzten Groschen, transferiert das Bargeld zur AAC-Mutterfirma und läßt die Firma anschließend ausbluten, bis sie Pleite geht oder man verkauft sie einfach, falls sich noch jemand findet, der noch ein paar Cents rausholen will. So hat man Werte in seinen Besitz gebracht, die weit über den Kapitaleinsatz beim Kauf hinausgehen und hat damit ein gutes Geschäft gemacht.
Eine andere Version ist, man kann den Umsatz/Absatz der Gesellschaft mit allen Mitteln aufblähen und sie dann zu einem deutlich höheren Wert weiterverkaufen, was ebenfalls ausgesprochen hohe Renditen erbringen kann, wenn man auf so etwas spezialisiert ist.
Siehe Näheres hierzu in diesem Artikel zu einem konkreten Fall.
Da diese ‚deals’ in der Regel nur bis zu zwei oder drei Jahre brauchen, manchmal sogar deutlich schneller abgewickelt weden können, sind hier Profitraten zu erzielen, die manchmal an die Werte 200 oder 300% im Jahr oder mehr herankommen, etwas, das mit einer Produktions- oder Service-Firma unmöglich erzielt werden kann.
Der tendenzielle Fall der Profitrate, den Karl Marx als erster analysiert hat und aus dem er die Schlußfolgerung gezogen hat, daß der Kapitalismus niemals zu stabilen Zuständen führen kann (wie prophetisch, wenn wir heute um uns blicken), zwingt die Großkapitalisten dazu, neue Anlagemöglichkeiten für die immensen Mengen neuen Kapitals zu suchen, das ihnen zufließt und dabei, so weit es noch möglich ist, der Falle der im Schnitt ständig sinkenden Profitraten zu entkommen.
Der einzige Wermutstropfen bei der Geschichte ist, daß ein nicht unwesentlicher Teil der Profite an die jeweils beteiligte Bank (oder Banken) fließen muß, die für solche Geschäfte unabdingbar sind. Wirklich große AACs haben sich darum bereits (eine) eigene Finanzierungsgesellschaft(en) zugelegt. Die Bank hilft am Anfang, den Kauf der ins Auge gefaßten Firma durchzusetzen und hilft auch bei der Finanzierung des Kaufs. Später gibt sie dann die Kredite, für die sie als Sicherheit die Werte der jeweiligen Firma bekommt. Da diese Firma aber nach dem ‚deal’, wie die Bank ja schon vorher weiß, (fast) nichts mehr Wert sein wird, sind das natürlich faule Kredite. Die Bank wird sie nur geben, wenn sie auf der anderen Seite auch an den Profiten beteiligt wird.
Hier eine (bereits überholte) Liste von Firmen, die unter dem Namen „Private Equity“ zusammengefasst wurden, wie sie im Forum von 'Rbi-aktuell' gepostet wurde. Dies ist die Liste, die in der SPD umlief:
Private-Equity-Branche in der BRD:
(Die US-Liste ist 10-mal länger)
aaFortuna Venture Capital & Management AG
AdAstra
AdCapital AG
AdVal Capital Management AG
Advantec Unternehmensbeteiligungen
AFINUM Management GmbH
AIB
Alchemy Partners
Allianz Venture Partners
Alpha Beteiligungsberatung Gmbh
Apollo Capital Partners GmbH
Arcadia Beteiligungen
S Venture GmbH
Atrium Private Equity GmbH
Aurelia Private Equity
AVIDA Group
Axiom Venture Capital
b-business partners Gmbh
aader Wertpapierhandelsbank AG
Baltik AG
BASF AG
Bay BG Bavarian Venture Capital Corp.
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
Bayern Kapital
Baytech Venture
BBB Bürgschaftsbank
BC Brandenburg Capital
Berlin Capital Fund
Berlin Seed Capital Fund GmbH
BFD Capital GmbH
BHF Bank AG
BHF Private Equity
BioM AG
BLB Private Equity
Blue Capital Equity GmbH
BMP
Botts & Company Ltd.
Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Brockhaus Private Equity
BTG Hamburg
BV Capital
BW-Venture Capital GmbH
Capiton ag
Carlyle Group Germany
CAT Venture
CBR Management
CEA Capital Partners Management gmbh
Centennium Capital Partners
Cinven
CMP Capital Management-Partners
Commerz Beteiligungsgesellschaft mbH
Concord Effekten AG
Copan gmbh
Cornerstone Capital
Daimlerchrysler Venture gmb
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgellschaft
Deutsche Beteiligungs AG
DEWB
DIH Finanz und Consult GmbH
Doughty Hanson & Co
Dr. Neuhaus Techno Nord
Dresdner Kleinwort Capital Germany
DVC Deutsche Venture Capital
DZ Equity Partner
e-millennium Partners
Earlybird
ECM Equity Capital Management GmbH
Econa AG
Elevator GmbH
EMBL Ventures
EQT Partners
Equinet Venture Partners
Equita Beteiligungen KgaA
Ergo Equity Partners
Extra Industries
Feri Trust
Finatem Beteiligungs GmbH
Firestorm AG - Capital Partners
First Ventury ag
Frankfurt Capital
General Atlantic Partners LLC
Germanincubator GI
Global Finance Beratungs AG
Global Life Science Ventures (GLSV)
Granville Baird Capital Partners
Greenwich AG
GZ-Capital Partner GmbH
Halder GmbH
Heidelberg Innovation gmbh
Heptagon Capital Beteiligungsgesellschaft der Freien Sparkassen mbH & Co. KG
Hg Capital GmbH
HGU Hamburger Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft
High Tech Management GmbH
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Hunzinger Information AG
IBB Beteiligungsgesellschfat mbh
IKB Venture Capital gmbh
IMH Industrie Management Holding
Infineon Ventures gmbh
Innotech Innovationen
Innovativ Capital AG
IT-Adventure
IVC Venture Capital ag
Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG (KDV)
KapitalBeteiligungsgesellschaft für das Land Brandenburg mbH
Kapitalbeteiligunsgesellschaft für die Mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen mbH
Kappa IT ventures
Kero Holding
Klaus Tschira Foundation
Konsortium AG
Kremlin AG
Lampe mbH
LeVenture Kapital
Life Science Partners
Life Science Ventures
M Cap Finance
Maier & Partner AG
MAZ level one GmbH
MBG
MBMV
MediaVenture Capital
Medicis
Mediport VC Management GmbH
MicroVenture GmbH & Co. KgaA
Mittelstandische Beteiligungsgesellschaft Hessen
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH
MUK Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH
MVC Venture Capital AG
myQube
Nexus Capital GmbH
NIB Norddeutsche Innovations
Nordcapital
Norddeutsche Private Equity gmbh
Nordwind Capital
NPM Capital Beteiligungsberatung GmbH
NWD Nord-West-Deutsche
Odewald & Compagnie
Orlando Management GmbH
Palladion Partners gmbh
Pari Capital AG
Pegasus Beteiligungen AG
Peppermint Financial Partners
Polytechnos Venture-Partners gmbh
pre-IPO Aktiengesellschaft
Pricap Venture Partners
Proximitas ag
RBB Management AG
RBK Regionale
Risikokapital-Fonds Allgäu GmbH & Co. KG
S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau mbH
S-Siegerlandfonds
S-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Leipzig mbH
S-VC Risikokapital-Fonds
Saarlandische
Sachsen LB Corporate Finance
Sal Oppenheim JR & cie
SBG - Sächsische Beteiligungsgesellschaft mbH
Schleswig-Holsteinische Kapital
Schuering & Andreas
SEED Capital Brandeburgh gmbh
SHS
Siemens Venture Capital Gmbh
Smart IPO AG
Solutio ag Anlagekonzepte fuer Institutionen
SPARK GmbH
Sparta Beteiligungen AG
Stauferkreis AG
SÜD Venture Capital gmbh
SüdKB Süd-Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft mbH
T-Telematik venture Holding Gmbh
T-Venture
TakeOff VC Management
Target Partners
Techno nord vc gmbh
Technologie-Beteiligungsgsellschaft mbH der Deutsc
TechnoMedia Kapital
TechnoStart
TecVenture Partners gmbh
Terra Firma Capital Partners
TFG Venture Capital FoF
Triangle Venture Capital
TVM Techno Venture Management Germany
UBAG Unternehmer Beteiligungen
UCA AG
VCH Equity Group
VCI gmbh Beratung Fur Technologieinvestitionen
VCM Venture Capital Management
VEAG mbH
Ventizz Capital Partners
Venture Capital Thueringen GmbH & Co. KG
Venture Vision
VISION Chancenkapital
Wagniskapital
WeHaCo Unternehmensbeteiligungs-AG
Wellington Partners Venture Capital gmbh
Wellness Business Partners
WestLB Ventures
WestSTEAG Partners
WGZ Venture-Capital
Die Firmen bezeichnen sich vorzugsweise als “Private Equity” oder “Venture Capital” und lenken damit von ihrem Charakter als “Hedge-Fond-Gesellschaften” bzw. AACs ab. Hier seien aus der Liste noch einmal speziell die genannt, die große Konzerne bzw. große Banken darstellen bzw. deren Tochtergesellschaften:
Allianz Venture Partners
BASF AG
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
BHF Bank AG
BHF Private Equity
Daimlerchrysler Venture gmb
Dresdner Kleinwort Capital Germany
Heptagon Capital Beteiligungsgesellschaft der Freien Sparkassen mbH & Co. KG
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Siemens Venture Capital Gmbh
VEAG mbH
WestLB Ventures
WestSTEAG Partners
Wir haben hier also, nur daß das auch klar wird, ein “Who is who” des Großkapitals. Es handelt sich nicht etwa um kleine, neue Unternehmen von ein paar Emporkömmlingen, sondern (auch) um das wirkliche Monopolkapital.
Interessant in der Liste auch noch die deutsche Unterabteilung der Carlyle Group. Das ist jene dubiose Finanzierungsgesellschaft, die zum Teil in den Händen der Familie Bush (ja, des US-Präsidenten) liegt und zum Teil dem saudi-arabischen Königshaus gehört. Wer Michael Moore’s Dokumentation ‚Fahrenheit 9/11’ gesehen hat, weiß, was gemeint ist.
Was sind nun diese ‚Werte’ (Assets), die Firmen zu bieten haben, die zum Ziel dieser AACs werden?
- Zum einen haben die Firmen ja meist eigene Grundstücke und Immobilien, die einen leicht einzuschätzenden Wert darstellen.
- Darüber hinaus haben sie Maschinen und Anlagen, oft schon abgeschrieben. Da ist es ebenfalls nicht schwer, die Werte zu ermitteln.
- Drittens stellt die Firma als solche, als Marke oder jedenfalls als in den Kundenkreisen angesehene Lieferantin oder Serviceleisterin, einen Wert dar.
- Ein weiterer Teil des Gesamtwertes sind die Finanzen und Finanzanlagen der Firma. Gut geführte Firmen in Deutschland haben beträchliche Finanzpolster.
- Der fünfte ‚asset’ schließlich sind Kundenliste, Lieferantenliste und das „know how“, das in Form von Dokumenten und in Form von Wissen der Beschäftigten vorhanden ist. Dies wird der ‚immaterielle Wert’ der Firma genannt.
- Dazu kommen, sechstens, ‚weitere Werte’, darunter fallen vor allem Pensionsgesellschaften der Beschäftigten, die von der Firma verwaltet werden und ähnliches.
Der Unterschied, 400 Millionen Euro in diesem Fall, ist der Profit, hinter dem die AACs her sind. Das ist natürlich nicht alles reiner Profit, aber die Hälfte davon kann man am Ende wahrscheinlich als reinen Profit verbuchen. Nimmt man an, man braucht ein Jahr, um den Deal bei dieser Firma durchzuziehen, kommt man auf 200% Profit pro Jahr auf eingesetztes Kapital, das sind Traumwerte für jeden Kapitalisten.
In vielen Fällen lassen sich so hohe Profitraten aus den verschiedensten Gründen nicht realisieren, aber auch 50% pro Jahr auf eingesetztes Kapital sind immer noch Werte, die jedem Kapitalisten ein Glimmen in die Augen treibt.
Was sind die Gründe, warum Aktienkurse und Verkaufspreis, also der Marktwert einer Firma, einen so viel geringeren Wert repräsentieren als den wirklichen Firmenwert? Nun, ein ‚normaler’ Käufer, der keine AAC ist, sieht in der Firma ja nicht ihren Gesamtwert, er kann ja z.B. die Grundstücke und Immobilien nicht realisieren, kann ja das Geld der Pensionskasse nicht einstecken, kann sich ja nichts für den ‚immateriellen Wert’ kaufen. Für ihn, der die Firma weiter betreiben will, stellt sie ja nur den Wert dar, den sie jährlich an Überschuß an den Besitzer abwirft. Es ist offensichtlich, daß dies weit weniger ist als ihr Gesamtwert.
Worin besteht also der eigentliche ‚Trick’ der AACs? Eben darin, daß für sie der beleihbare Gesamtwert einer Firma ausschlaggebend ist, während sie nur den Marktwert der Firma für sie zahlen müssen.
Nun bauen verantwortliche Unternehmer natürlich eine Abwehrfront auf, um zu verhindern, daß sie einfach übernommen werden können. Als Beispiel kann die Fuchs Petrolub mit Sitz in Mannheim dienen, eine Firma der Größenordnung (ca. 4.000 Beschäftigte weltweit), die ideal für AAC-Übernahmen ist. Dort hat man z.B. die Firma an die Börse gebracht, die Entscheidungsgewalt aber gleichzeitig in der Familie der Besitzer gelassen.
Das macht man mit einem einfachen Trick: Man splittet die Aktien in Vorzugsaktien und Namensaktien. Stimmrecht über die Belange der Firma geben nur die Namensaktien, die Vorzugsaktien sind ohne Stimmrecht, geben aber höhere Dividenden. Man beläßt dann einfach die Mehrheit der Namensaktien in der Familie und hat so ständig das Sagen, genießt aber andererseits die Vorteile börsennotierter Firmen (man kann sich Bargeld (‚Cash’) an der Börse holen und die dafür zu zahlenden Dividenden hängen von der Gewinnsituation ab, während man bei Bankkrediten die Zinsen immer zahlen muss). Zusätzlich arbeitet man eng mit einer ‚Hausbank’ zusammen, in diesem Fall der Deutschen Bank, die einem erweiterten Schutz vor unerwünschten Käufern gewährt.
Das Ganze geht aber nur solange gut, wie einen die Bank nicht ‚verrät’, also mit einer AAC zusammenarbeitet und wie keine Streitereien in der Familie ausbrechen. Der Niedergang der Dornier-Gruppe z.B., die immerhin einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Kleinflugzeugen war, belegt, daß Streitigkeiten in der Besitzerfamilie oft zu Desastern führen.
Insofern ist die Konstruktion mit den Namensaktien auch ein zweischneidiges Schwert. Überwirft sich die Familie mit auch nur einem Familienmitglied, das einen wesentlichen Aktienanteil hat, wird die ganze Firma anfällig für eine AAC- (oder auch sonstige) Übernahme. Man braucht ja lediglich die an der Börse gehandelten Namensaktien aufzukaufen und das Paket des ‚Dissidenten’, schon hat man das Sagen in der Firma. Der zu investierende Wert z.B. bei einer Gesellschaft wie der Fuchs Petrolub wäre nicht einmal ein Zehntel des beleihbaren Gesamtwertes der Firma. Ein Leckerbissen!
Auch in solchen Fällen kann die Hausbank oft noch das Schlimmste verhindern, aber wehe, wenn sie gemeinsame Sache mit der AAC macht.
Ein klassischer Fall ist das Schicksal der Firma Grohe, einem der größten Anbieter von hochwertigen Sanitär- und anderen Armaturen weltweit, mit einem Jahresumsatz von 885 Millionen Euro im Jahr 2003 und 5.800 Mitarbeitern weltweit, eine jener Firmen, die charakteristisch für die deutschen Exporterfolge ist. Deutschland ist nicht umsonst Exportweltmeister.
Die Besitzer von Grohe schufen eine der solidesten Firmen ihrer Größenordnung. Es wurden praktisch keine Bankkredite aufgenommen, man war im Gegenteil seine eigene Bank und vergab Kredite, z.B. an Mitarbeiter, die sich ein Häuschen finanzieren wollten, mit Vorzugszinsen. Man baute eine Pensionskasse auf, die den Mitarbeitern einen angenehmen Lebensabend garantieren sollte. Die Expansion ins Ausland wurde behutsam und gezielt durchgeführt, ohne die eigenen Exporte zu beeinträchtigen. Kurz: Grohe war grundsolide und damit ein bevorzugtes Ziel der AACs.
Wenn heute Mitarbeiter von Grohe auf die Straße gehen mit Pappen, auf die sie geschrieben haben: „WIR sind Grohe“, so zeigt das beispielhaft, wie die Identifizierung der Belegschaft mit der Firma war: vollständig. Mit Standorten in ländlichen Regionen (Lahr, Hemer, Menden, Herzberg) und einer Belegschaft voll auf Unternehmenslinie, etwas Besseres kann eine AAC nicht finden.
Nun war Grohe nach Meldungen eines Internetportals an eine britische Investmentgruppe verkauft worden. Ob das auch schon eine AAC war, konnte nicht festgestellt werden. Jedenfalls wurde Grohe Mitte 2004 von den US-Firmeninvestoren ‘Texas Pacific Group’ und ‘Crédit Suisse First Boston Private Equity’ übernommen (man beachte die typische Zusammenarbeit einer AAC mit der Unterabteilung einer Bank). Zunächst ahnte niemand Schlimmes.
Die neuen Eigner war nicht als Hedge-Fond-Gesellschaft bekannt (der Begriff „private equity“ allein sagt noch nichts über die Absichten, auch wenn man in Zukunft aufmerksam werden sollte, wenn der Begriff auftaucht). Unbekannt sein ist in vielen Fällen natürlich Voraussetzung für ein reibungsloses Durchziehen des ‚Coup’, denn es gibt meist schwerste Widerstände, wenn von vornherein jeder weiß, wer der neue Besitzer ist und was er machen wird.
Aus diesem Grund werden auch andauernd neue AACs gegründet, deren Namen noch nicht auf den bekannten Listen stehen. Der oben zitierte US-Analyst sagte: „Täglich werden 10 neue gegründet und fünf gehen ein.“
Dazu kommt, daß die Firmen regelmäßig rettungslos verschachtelt sind, über andere Firmen, über Einzelpersonen und mit allen sonst noch möglichen Tricks. Die eigentlichen Holdings sitzen meist in Steuerparadiesen wie den Cayman Islands oder Jersey. Wird Geld aus den überfallenen Firmen herausgepumpt, wird es sofort durch hundertfache Überweisungen von Konto zu Konto „gewaschen“, aufgeteilt in kleine Portionen und verschwindet unnachweisbar im Orkus internationaler Transaktionen.
Zur völligen Sicherheit baut man oft noch eine sogenannte „Orange“ ein, über dessen Konto alles läuft. Das ist eine Person, die gar nicht existiert und für die jemand sich ausgegeben hat mit falschen Papieren. Bestimmte Banken, z.B. auf den Bahamas, sind bekannt dafür, vorgelegte Ausweis-Papiere nicht zu überprüfen (im Prinzip müssen Banken bei Ausländern die Identität bei der Botschaft des Heimatlandes überprüfen).
Selbst wenn es eventuell ein Fahnder schaffen sollte, das Geld über die vielen Konten zu verfolgen, trifft er plötzlich auf eine Einzelperson, an die das Geld gegangen ist, die nicht aufzufinden ist und daher auch keine Auskünfte geben kann.
Derjenige hebt in regelmäßigen Abständen die eingegangenen Gelder von „seinem“ Konto ab und zahlt sie auf der anderen Straßenseite bei einer Bank auf andere Konten wieder ein. Damit ist die Spur des Geldes nicht mehr zu verfolgen (dies ist übrigens generell eine beliebte Geldwaschmethode). Natürlich werden solche Konten mit falschen Identitäten ständig gewechselt, um nicht aufzufliegen.
Daß hier kriminelle Methoden verwendet werden, hängt damit zusammen, daß dies einer der Schwachpunkte des Vorgehens ist. Man ist zwar Besitzer der Firma, muß aber nun große Mengen Geld hinausschaffen, ohne allzuviel Aufsehen zu erregen. Bestimmte Mengen kann man noch über Umleitung von Rohstoffkäufen über eine Firma der Gruppe der AAC mit überhöhten Preisen verschieben, andere können mit Beratergebühren, fingierten Gutachten, hohen Rechnungen für Meetings bei der AAC und ähnlichem außer Haus geschafft werden. Auch darf die Besitzerfirma natürlich angemessene Gewinnabführungen verlangen.
Ebenso ist es ein probates Mittel, jeden Tag eine Überweisung eines „krummen Betrages“ unter einer ständig wechselnden Begründung zu veranlassen. Solche Begründungen sind z.B. ‚außerordentliche Aufwendungen’ (Synonym für Bestechungsgelder), ‚Reisespesen Direktor Smith’ (das sich eine entsprechende Reisekostenabrechnung nicht finden läßt, ist dann eben Schlamperei), ‚Aufwandsentschädigung für Nachprüfungen’ usw. usw. Sind das täglich Beträge um die 20.000 Euro, hat man am Ende des Jahres mehr als 6 Millionen überwiesen.
Aber richtig große Geldmengen im Bereich von 100 Millione Euro kann man nicht mehr „unter der Hand“ verschieben. Da muß dann wirklich von der verantwortlichen Person eine Überweisung angeordnet werden mit der einzigen Begründung, daß sie von der verantwortlichen Person angeordnet wurde. Oft läßt die sich das Geld auch bar übergeben. Sollte später, wenn die Firma schon bankrott ist, eine Untersuchung angestellt werden, ist der damals Verantwortliche längst in Neuseeland oder „nicht mehr in der Firma“ oder sonstwie nicht anzutreffen und zu befragen, warum er das angeordnet habe (man arbeitet in besonders krassen Fällen auch mit falschen Identitäten).
Tatsache ist, Grohe ist heute völlig überschuldet, obwohl man noch vor kurzem keinerlei Bankkredite hatte. Wie und wo das ganze Geld hin ist, scheint ein Rätsel zu sein. Auch aus der Pensionskasse scheint Geld verschwunden zu sein. Im Moment ist man gerade in der Phase, wo man sich noch den Anschein gibt, als wolle man das Überleben der Firma durch Lohnsenkungen, Entlassungen, Aufgeben von Standorten, Verlängerung der Arbeitszeit und den weiteren bekannten Maßnahmen sicherstellen, doch mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich bald herausstellen, daß schon gar keine Überlebensfähigkeit mehr besteht.
Besonders kurios ist, daß ausgerechnet jetzt mit dem lächerlichen Argument der Arbeitsplatzabbau begründet wird, im Ausland seien die Löhne niedriger. Der Niedergang von Grohe hat natürlich mit den Lohnkosten soviel zu tun wie die Kuh mit dem Tanzen. Die mit einem Gutachten beauftragte McKinsey-Gruppe hätte mal untersuchen sollen, wie und wohin das Geld verschwunden ist, aber das ist natürlich nicht ihre Aufgabe. Die finden immer genau das heraus, was sie finden sollen.
Sehr charakteristisch auch das Argument, das man gegenüber der Belegschaft im Werk Herzberg gebracht hat, das vollständig geschlossen werden soll: Die Belegschaft könne ja das Werk kaufen! Der Zynismus dieser ‚Herren’ kennt offenbar keine Grenzen. Selbst wenn das Werk für einen symbolischen Euro verkauft würde (was diese ‚Herren’ natürlich nicht machen würden), stünde die Belegschaft da mit einem Schuldenberg, der unmöglich zu bezahlen wäre.
Im Fall Grohe ist nicht mehr genau festzustellen, wer die eigentliche AAC war. Wahrscheinlich schon jene britische Investmentgruppe, die zuerst zugeschlagen hat. Eventuell ist der momentane Besitzer sogar an einer Sanierung interessiert, aber viel wahrscheinlicher ist, daß sich nach dem ersten Überfall noch eine zweite AAC über die Reste hergemacht hat. In diesem Fall dürfte die Grohe in Wirklichkeit längst Pleite sein und man „spielt“ nur Sanierung, damit es nicht so auffällt.
Die verschiedensten Vertuschungsmethoden sind natürlich bei den Überfällen der AACs gang und gäbe. Manchmal wird wegen der Notwendigkeit des Vertuschens von dem, was wirklich vorgeht, der Zeitraum für das Umsetzen des ‚coup’ unangenehm lang, was natürlich die Profitrate verringert. Aber die Firmen können nicht alle völlig ohne einen gewissen „Anschein“ vorgehen. Das trifft besonders auf die zu, die große Monopole sind oder deren Tochterfirmen. Diese können natürlich nicht solche Methoden wie die oben genannten „Orangen“ anwenden, ebensowenig den verantwortlichen Chef, der sich mit einem falschen Pass ausgewiesen hat und am Ende spurlos verschwindet, auch die Geldwäsche und die Holding auf den Cayman Inseln funktionieren da nicht.
Ein Beispiel ist das Engagement der BMW bei Rover/Leyland in England. Zunächst gab man sich den Anschein, als wolle man wirklich die Marke Rover wieder aufpolieren und weiterführen. Wer aufmerksam beobachtete, sah allerdings bereits, daß man nie so weit ging, ein Rover-Auto an prominenter Stelle in BMW-Verkaufsräume zu stellen.
Zunächst verkaufte man die Gewinn abwerfende Sparte Land Rover. Wo das Geld dieses Verkaufs geblieben ist, ist bis heute nicht geklärt. Dann erklärte man Monat für Monat, man mache gewaltige Verluste. Dies ist einerseits nicht zu überprüfen und hat andererseits den Vorteil, daß man dies mit Gewinnen aus der Muttergesellschaft verrechnen kan. Damals ergab das noch einen Sinn, den es gab noch eine geringfügige Besteuerung von Gewinnen von Großkonzernen in Deutschland, die heute ja praktisch abgeschafft ist.
Daß während dieser ganzen Zeit BMW dafür gesorgt hätte, daß Rover attraktive Autos baut und auf dem Markt vorankommt, kann niemand behaupten. Lediglich den Mini brachte man neu heraus und hatte ein attraktives Nischenauto, die anderen Neuerscheinungen hatten nicht das geringste von einem BMW-Flair.
Als BMW sich von Rover verabschiedete, nahm man den Mini mit und hinterließ eine ausgeblutete Firma mit riesigen Schuldenbergen. Die wurde dann von einer kleinen Investmentfirma übernommen, die wiederum verkündete, sie werde die Marke Rover und die Fabrik sanieren. Tatsache ist, daß die Investmentfirma noch mehr Kredite auf die Rover nahm und schon nach recht kurzer Zeit den Vergleich anmeldete und von der Bühne verschwand. Die Abwicklung des Restes überließ man den Vergleichsverwaltern und damit dem englischen Staat, der dann, wie üblich, die Drecksarbeit des Entlassen der restlichen Mitarbeiter für die AACs übernimmt.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch bei Grohe nichts anderes zu erwarten. Wenn die „Heuschrecken“ abgegrast haben, wird der Staat zu Hilfe gerufen.
Die Regelungen des Vergleichsverfahrens oder Konkursverfahrens sind beeindruckend. Der frühere Besitzer wird in keinster Weise mehr behelligt, Untersuchungen über die Ursachen der Schuldenberge werden nicht angestellt, der eingesetzte Vergleichsverwalter verdient sich noch ein kleines Vermögen, die Banken jammern, sie verlören Geld, nachdem sie vorher Kredite an eine Firma gegeben hatten, von der sie wissen mußten, daß sie ausgelutscht wird (weil sie selbst daran beteiligt waren) und die entlassenen Mitarbeiter haben nicht einmal mehr eine Instanz, wo sie die ausstehenden Löhne einklagen könnten.
Im Kern ist jeder AAC-Coup kriminell, weil die Techniken des Entfernens der Gelder aus der Firma kriminell sind, in der Regel einfach 'Untreue', ‚Betrug’ oder auch ‚Veruntreuung’. Allerdings kann das ganze meist perfekt vertuscht werden, weil in einer kapitalistischen Firma ja Tyrranei herrscht. Der Besitzer oder dessen Beauftragter haben die Befugnisse absolutistischer Herrscher.
Ob die Regeln korrekter Buchführung angewandt werden, entscheiden allein sie, ob über bestimmte Anweisungen schriftliche Aufzeichnungen in die Akten kommen, entscheiden allein sie, sie können kriminelle Aktionen ihrer Untergebenen befehlen, die dann nur noch entscheiden können, ob sie gehorchen oder ihren Arbeitsplatz verlieren. Kurz: Die Möglichkeiten, ihre Straftaten unkenntlich zu machen oder sogar Untergebenen aufzuhalsen, sind unendlich. Irgendeine neutrale und kritische Überprüfung von Buchführung und Unternehmensentscheidungen gibt es nicht. Die Bilanz-Überprüfungen durch Firmen wie KPMG oder anderen sind nichts als Alibi-Veranstaltungen.
Ein Mitarbeiter, z.B. ein Buchhalter, der zu kriminellen Techniken gezwungen wurde, ist selbst mitschuldig und wird sich hüten, diese Straftaten offenzulegen, auch nach dem Ende einer Firma.
Die gleiche Bundesrepublik, die fast allen Tätern der faschistischen Verbrechen Straffreiheit gewährt hat, weil sie ja angeblich „im Befehlnotstand gehandelt“ hätten, ist nicht bereit, Firmenbeschäftigten das gleiche Privileg „Befehlnotstand“ zuzugestehen. Wenn eindeutig ist, daß der Mitarbeiter nichts zu seinem eigenen Vorteil getan hat und er glaubhaft machen kann, daß er bei Ungehorsam entlassen worden wäre, bekommt er bestenfalls ‚mildernde Umstände’. Andererseits werden die Verantwortlichen für solche Straftatbestände praktisch nie verurteilt. Der Prozess gegen Ackermann hat exemplarisch gezeigt, daß es fast unmöglich ist unter den herrschenden Umständen, jemandem schuldhaftes Handeln nachzuweisen, wenn er zu jener Zeit das Sagen in einer Firma hatte.
In diesem Sinne handeln die AACs am Ende doch nicht kriminell – jedenfalls läßt es sich nicht nachweisen. Falls sich etwas nachweisen läßt, sind die Verantwortlichen nicht aufzufinden und die Firmen in Steuerparadiesen kann man sowieso für nichts verantwortlich machen.
Natürlich wäre es möglich, mit gesetzlichen Maßnahmen einem solchen Treiben ein Ende zu setzten. Daß es dazu irgendeinen politischen Willen im heutigen Kapitalismus gibt, kann ausgeschlossen werden. Der Kommentar der „Financial Times“ war deutlich: „Wer von Heuschrecken redet, will noch mehr Staatskontrolle über die Unternehmen.“ NOCH mehr, welch ein Horror!
Den Betroffenen wird nichts anderes übrig bleiben, als zäh und kühn um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und vor allem sich klarzumachen, daß für die Zukunft ihrer Kinder der Sozialismus erkämpft werden muß.
Bleibt noch eine weitere Frage zu klären: Sind die Hedge-Fonds-Gesellschaften oder AACs die Zukunft des Kapitalismus? Kann der Kapitalismus mit ihnen eventuell das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate überlisten?
Nein, das wäre ein grundlegender Irrtum. Was die AACs aus den Unternehmen herausholen, ist ja ‚eingefrorener’ Profit von vorher. Sie schaffen ja keinerlei neuen Profit. Ein Unternehmer, der solide wirtschaftet und noch viele Jahre etwas von seiner Firma haben will, beläßt wesentliche Teile seines Profits in der Firma, um sie zu stärken und so seinen zukünftigen Profit zu sichern.
Die AAC holt lediglich in kurzer Zeit diesen angesammelten Profit aus der Firma.
Dazu kommt, daß die Zahl der von AACs auszusaugenden Firmen sich in engen Grenzen hält. Zunächst sind schon einmal alle kleineren Firmen (in der Größenordnung bis zu etwa 500 Beschäftigten) für diese Art der Betätigung nicht geeignet, weil bei ihnen einfach nicht viel zu holen ist. So eine AAC hat ja auch Kosten. Ein erfahrener Chef für die auszusaugende Firma würde der AAC pro Jahr bei einer kleineren Firma schon mehr kosten, als er dort überhaupt rausholen kann.
Auch wirkliche Großunternehmen, erst recht die Monopole, stehen den AACs nicht zum Aussaugen zur Verfügung. Diese großen Konzerne sind ja fast ausnahmslos Aktiengesellschaften mit größenordnungsmäßig 100.000 bis 500.000 Aktien an der Börse. Solche Mengen von Aktien kann man natürlich nicht still und heimlich aufkaufen, ohne aufzufallen.
Außdem haben zum Beispiel alle deutschen Momopolunternehmen eine Höchststimmrechtsklausel im Gesellschaftsvertrag. Jemand mit mehr als z.B. 10% der Aktien hat trotzdem nur Stimmrecht für 10 %. Die Herren in den Monopolunternehmen sind ja die Vorstände, keineswegs mehr die Besitzer. Die Aktionäre sind lediglich Stimmvieh.
Es gibt also praktisch nur eine Möglichkeit, Großkonzerne und Monopolunternehmen aufzukaufen: man kann ein Übernahmeangebot unterbreiten und hoffen, daß sich genug Aktionäre finden, die es annehmen. Besteht auch nur die geringste Möglichkeit, daß die Gesellschaft, die das Angebot unterbreitet, die Firma lediglich aussaugen will, wird der Vorstand dies den Aktionären schon klarmachen und sie werden ein solches Angebot nur annehmen, wenn es meilenweit über dem Aktienkurs läge. Damit aber würde der schöne Profit schon wieder draufgehen. Die AACs haben ja kein Interesse, die früheren Aktionäre reich zu machen, sie wollen ihre Firma bereichern.
Die Zielgruppe der AACs beschränkt sich also im wesentlichen auf mittlere Firmen, im Bereich von etwa 500 Mitarbeitern bis etwa 10.000 Mitarbeitern – in Ausnahmefällen bis zu 25.000.
Aber auch diese sind zum allergrößten Teil unverkäuflich. Sei es, daß es GmbHs sind und die Eigner nicht verkaufen, sei es daß sie sich über Namensaktien abgesichert haben und nicht verkaufen oder sei es, daß sie die oben schon genannte Höchststimmrechtsklausel im Gesellschaftervertrag haben. Es gibt auch weitere Klauseln, wie eine Gesellschaft sich gegen unerwünschte Übernahmen schützen kann. In vielen Gesellschafterverträgen ist z.B. geregelt, daß ein Verkaufswilliger seine Anteile (oder Aktien) zunächst den anderen Eignern zum Kauf anbieten muß, bevor er nach außen verkaufen darf.
Dazu kommt die Rolle der Hausbanken. Gegen deren Willen ist fast nichts möglich. Solange die Hausbank sich mehr verspricht von einer weiter bestehenden Firma als von den Gewinnen, die beim Aussaugen abfallen, ist kaum etwas zu machen.
Kurz: Auch innerhalb der Zielgruppe sind nur äußerst selten Schnäppchen zu finden, die übernommen und ausgesaugt werden können. Das „know how“ der erfolgreichen AACs besteht hauptsächlich darin, solche Firmen zu finden. In einem Land wie Deutschland dürften kleine Heerscharen von „Ermittlern“ unterwegs sein, um mögliche Kandidaten herauszufinden und den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen zu eruieren.
Erfährt man zum Beispiel, daß der „Patriarch“ einer Firmengruppe gestorben ist und sich Gerüchte über Erbstreitigkeiten halten, dann kann die AAC wie ein Phönix aus der Asche als Lösung aller Probleme auftreten und den Streithähnen ein sattes Angebot für die Firma vorlegen. Oft ist die Habgier so groß, daß es angenommen wird.
Es gibt also nur selten gute und lohnende Objekte für die AACs. An den beiden oben genannten Beispielen konnte man auch schon sehen, daß sich hier offenbar nacheinander zwei AACs an so einem Brocken gütlich getan hatten. Ebenso kommt es vor, daß eigentlich wenig solide Firmen übernommen und leergesaugt werden, was natürlich weit weniger Profitrate erbringt. Da heute das Aufsteigen neuer Gesellschaften relativ selten ist, kommt auch wenig Nachschub. Die möglichen Kandidaten werden also tendenziell auch noch weniger.
So ist also klar, daß die AAC-Hausse eine zeitweilige ist und für die Geldanleger im allgemeinen kein Problem löst.
Der Kapitalismus hat keinen Ausweg. Die Kapitalisten haben ihre Totengräber schon geschaffen und sind auch noch gezwungen, sie in Wut und Rage zu bringen. Wenn nicht alles täuscht, ist ihr Ende damit besiegelt.
Ein Artikel (besser : Dossier) von Elmar Getto aus dem Jahr 2005, hier geringfügig vom Autor redigiert. Beeindruckend, wie aktuell und taufrisch dies auch heute noch ist, auch wenn die Liste mit den "Heuschrecken" in Deutschland schon überholt sein dürfte. Er erschien damals bei 'RBI-aktuell'.