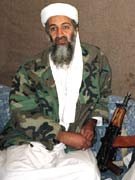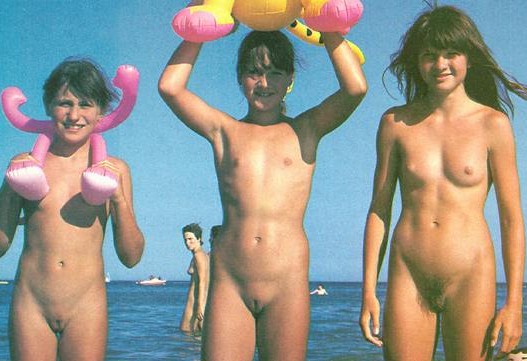Ein Personalchef packt aus
Von Elmar Getto
Dieser Artikel wurde am 27.07.05 in der "Berliner Umschau" (damals noch "Rbi-aktuell") veröffentlicht. Er ist ein wichtiges Dokument, denn die heutige Krise ist nicht vom Himmel gefallen. Sie hat lang zurückreichende Ursachen. Die hier dargelegte Politik, der wahnwitzige Personalabbau um seiner selbst willen und die Frühverrentungen in kaum glaublichem Ausmass (die auch mit der Rentenkasse und der Arbeitslosenkasse aufräumten) sind ein wesentlicher Teil des Abbaus der Kaufkraft Deutscher Arbeitnehmer, die jetzt die wesentliche Krisenursache darstellt.(Anmerkung von 2009)
Im folgenden werden die Aussagen des (ehemaligen) Personalchefs einer größeren deutschen Firma wiedergegeben, die er in einem Interview mit Rbi-aktuell machte. Er besteht aus naheliegenden Gründen auf absoluter Anonymität. Wir haben darum auch Teile der Aussagen, die Rückschlüsse auf die Firma zulassen könnten, in der er arbeitete, weggelassen. Auch ohne sie ergibt sich ein eindrucksvolles Bild der ‚Fähigkeiten’ deutscher Spitzenmanager.
„Es begann Anfang der 80er-Jahre. Die Firma war erfolgreich, aber man konnte nicht die geplanten Steigerungsraten in Absatz und Umsatz erreichen, auch der Jahresgewinn vor Steuern nahm nicht mehr zu. (...)
Man hatte bereits seit Jahren einen großen Teil der Investitionen bei den Auslandsgesellschaften gemacht und für ...[neue Fabriken in Übersee] verwendet. Die Investitionen im deutschen Mutterhaus wurden nun praktisch ausschließlich für Rationalisierungsmaßnahmen und zur Automation verwendet.
Bereits seit 1979 gab es einen allgemeinen Einstellungsstop. Stellenausschreibungen mußten ausnahmslos vom Vorstand genehmigt werden – und der genehmigte so gut wie keine. 1982 begannen die ersten Entlassungen. Man hatte alle Abteilungsleiter angewiesen, die bekannten „Minderleister“ zu entlassen.
Wir in der Personalabteilung mußten diese als personenbedingte Entlassungen tarnen. Wir begannen Abmahnungen zu verteilen und dann – in angemessenem Zeitabstand – die Entlassung auszusprechen. Das wurde allerdings relativ teuer, denn fast alle gingen vor Gericht und erreichten einen Vergleich mit Zahlung einer Abfindung, die fast immer dem Lohn von mehreren Jahren entsprach. Es gab also keine kurzfristige Kostenentlastung – im Gegenteil. (...)
In diesen Jahren war immer mehr und mehr von Kostensenkung die Rede. Wir pflegten zu sagen, wir produzieren nicht mehr (...), sondern Kostensenkungen.
In jener Zeit war unser Lohnkostenanteil an den Gesamtkosten bereits auf 32% gesunken. Das paßte aber meinem Chef, dem Zuständigen im Vorstand für Personal und Entwicklung, nicht. Er wies mich an, eine andere Rechnung aufzumachen, in der ich den gesamten Anteil der Abschreibungen und der Zinsen aus den Kosten herausnahm und dann den Lohn- und Gehaltskostenanteil (einschließlich Sozialleistungen) an den „laufenden Kosten“ ermittelte. Da kamen wir damals immerhin noch auf 51%. (...)
Bei dieser Geschichte wurde auch deutlich, wie wenig unser Vorstand ein kollegiales Gremium war, wie wenig abgesprochen wurde und wie viele Intrigen dort gesponnen wurden. Etwa ein-einhalb Jahre danach wurde ich nämlich zu einer hochnotpeinlichen Befragung bei einigen Vorstandsmitgliedern vorgeladen. Sie wollten wissen, warum wir so deutlich höhere Personalkosten hatten als unsere Konkurrenten. Wir mit 51%, jene mit annähernd 30%. Ich erklärte, daß wir anders rechneten und daß dies auf Anordnung des Personal- und Entwicklungsvorstandes geschah. Kurz danach wurde jenes Vorstandsmitglied „auf eigenen Wunsch“ von seinen Aufgaben entbunden und ein junger Jurist wurde nun mein neuer Chef, der sich einen Sport daraus machte, ausschließlich im Befehlston mit mir zu sprechen.
Die nächsten Entlassungen bereiteten wir besser vor. Der Vorstand hatte uns aufgetragen, eine mindestens 3% des Personals umfassende Entlassungs-Kampagne zu planen. Wir beriefen also eine Sitzung mit dem Betriebsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter ein und erklärten, warum aus betriebsbedingten Gründen diese Entlassungen notwendig seinen. Die beiden erklärten uns, ihnen gehe es darum, solche Entlassungen ‚sozialverträglich’ zu gestalten und schlugen vor, eine Frühverrentungsaktion zu starten, die bis zu dem Lebensalter ginge, bei dem die 3% erreicht würden. Man bestehe aber darauf, daß wir zunächst das Ganze auf einer Betriebsversammlung als Entlassungen ankündigen.
Und so funktionierte es. Auf der Betriebsversammlung traten Betriebsratsmitglieder auf und schimpften schrecklich. Danach war die Belegschaft wegen anstehender Entlassungen verunsichert. Wir gaben vor, tagelang mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Dann gab der Betriebsrat ein Rundschreiben heraus, er hätte in ‚zähen Verhandlungen’ die Entlassungen in eine „Frühpensionierung“ umwandeln können. Das sei ‚sozialverträglich’. Es würden lediglich jene betroffen sein, die 59 und älter seien. Auch werde das Ganze auf freiwilliger Grundlage ablaufen.
Dann begannen wir, alle ab 59 einzeln in die Personalabteilung vorzuladen und ihnen die Vorteile der Regelung anzupreisen. Sie würden offiziell erst mit 65 in Rente gehen, also keine Abstriche an der Rente hinnehmen müssen. Für die Übergangszeit bis dahin erhielten sie einen monatlichen „Frührente“-Betrag, der etwa in der Höhe ihrer späteren Rente lag, die wir jedem einzelnen vorrechneten. Dieser Betrag wurde zum Teil von der Bundesanstalt für Arbeit, zum Teil von den Rentenversicherungsträgern übernommen. Wir zahlten lediglich einige ‚peanuts’.
Fast alle nahmen das Angebot an. Eine kleine Anzahl an Ablehnungen hatten wir schon eingerechnet, sonst hätten wir das Anfangsalter auf 60 legen können. So aber erreichten wir sogar ein wenig mehr als die 3%. Das Ganze kostete fast nichts, wir hatten die Lohnkosten deutlich gesenkt und die erschrockene Belegschaft arbeitete locker für die drei Prozent mit. Allein die Senkung des Krankenstandes aufgrund des „Entlassungs“-Schocks und der Anstieg von freiwilligen unbezahlten Überstunden waren so bedeutend, daß wir hinterher mehr geleistete Arbeitsstunden hatten als vorher.
Etwa ab diesem Zeitpunkt begannen wir auch die Ausbildung herunterzufahren. Wir waren traditionell einer der großen Ausbildungsbetriebe der ganzen Region gewesen. Wir hatten sogar ein Lehrlingswohnheim für Lehrlinge aus den entlegenen Regionen der (...), das nun geschlossen wurde. Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde zunächst um etwa 20% verringert und wir begannen jedes Jahr erneut eine Prozentzahl der Übernahmen nach der Lehre festzulegen, die nun nie mehr 100% erreichte.
Das war zu jener Zeit, als sich eine Gruppe von „Linksaußen“ in unserer Fabrik zusammengetan hatte und begann, Flugblätter an den Eingangstoren zu verteilen. Sie griffen den Betriebsrat an, daß er dem Abbau von Arbeitsplätzen ohne Kampf zugestimmt hatte, forderten die Übernahme aller Auszubildenden und ähnliches. Zuerst ließen wir sie einfach links liegen. Wir identifizierten lediglich die Flugblattverteiler, alles Studenten aus (...).
Bei den nächsten Betriebsratswahlen stellte die Gruppe eine Oppositionsliste gegen die Liste der [Name der DGB-Gewerkschaft] auf. Alle wurden aus der Gewerkschaft ausgeschlossen. Sie erhielten auch einen Betriebsratssitz. Allerdings hatten wir nun die vollständige Liste aller Mitglieder und konnten sie versetzen, so daß sie weit entfernt voneinander arbeiteten und sie unter spezielle Überwachung stellen, so daß ihnen Kontakte während der Arbeitszeit erschwert wurden. Wir schickten auch Leute zu ihren Treffen. Dort wurde klar, daß sie nie über zwei oder drei Leute aus dem Betrieb als „Sympatisanten“ hinauskamen, die sie versuchten, zum Beitritt zu ihrem Klub zu überreden. Und davon war einer noch „unser“ Mann.
Im Laufe der Zeit gelang es uns, alle aus dem Betrieb zu entfernen. Der Betriebsrat half uns dabei, denn man wollte auch keine unliebsamen Kritiker. Fast alle wurden personenbedingt entlassen. Wenn ein Meister z.B. ein Fehlverhalten bezeugte, gab es wenig zu deuteln an diesen Entlassungen. Einer z.B. hatte sich für einen Gang zum Betriebsrat abgemeldet, aber die Betriebsräte bestätigten, daß er nicht im Büro bei ihnen war. Wupps, war er draußen. Da wir diese Entlassungen über eine Anzahl von Jahren hinzogen, gelang es ihnen auch nie, eine Bewegung dagegen zu entfachen. (...)
Zwei Jahre nach der ersten Entlassungswelle über Frühpensionierungen war der Appetit des Vorstands auf eine neue Aktion dieser Art geweckt. Zwar gab es keinerlei Probleme mit den Steigerungsraten des Absatzes und auch der Gewinn war hervorragend, aber der Vorstand meinte, er könne höher sein. Diesmal mußten wir etwas erfinden, um die neue Welle der Frühpensionierungen zu „verkaufen“. Erneut „schluckten“ es aber sowohl die Älteren, die in Frührente gingen, als auch die Belegschaft und der Betriebsrat.
Die „Linken“, zu diesem Zeitpunkt noch im Unternehmen, versuchten eine Abwehrfront aufzubauen, aber es gelang ihnen nicht. Die Argumentation des Betriebsrates, nur so könnten betriebsbedingte Entlassungen verhindert werden, setzte sich durch.
Diesmal hatten wir die Altersgrenze auf 58 Jahre gelegt. Dadurch kamen die beiden Jahrgänge, die schon wieder hineingewachsen waren und ein weiterer Jahrgang in den Bereich der Frühpensionierung. Das waren zu diesem Zeitpunkt fast 4% der Belegschaft, die so hinausbefördert werden konnten.
Diesmal waren die Bedingungen für die Frührentner schon nicht mehr so günstig wie bei der ersten Aktion, doch die Früpensionierten hatten sich nicht alles durchgelesen und bemerkten es erst hinterher. Für uns war wiederum wesentlich, daß wir die Übergangszahlungen fast völlig auf die Rentenkassen und Arbeitslosenkassen abwälzen konnten. Wiederum klappte es im wesentlichen, daß der Rest der Belegschaft deren Arbeit mitmachte, wenn es auch zu einzelnen Reklamationen kam.
Dann kamen die neunziger Jahre. (...) Nun hatten wir auch einen Standort im Osten. Jede neue Produktionslinie wurde nun ausgeschrieben, ob man sie in [Ausland], im Osten oder im Mutterwerk ansiedelt. Alle mußten Kosten senken oder es wurde wieder mit Entlassungen gedroht. (...)
Das waren die großen Zeiten der Flexibilisierung. Wir konnten weitgehend die Überstundenzuschläge abschaffen. Das ergab deutliche Einsparungen. Die Produktionsarbeiter bekamen Stundenkonten, auf die ihre Überstunden kamen und wenn die Konten bis an die Grenze voll waren, akzeptierten die meisten weitere Überstunden, die dann verfielen. Auch dieser Effekt ergab Kosteneinsparungen. Zusammen mit den Automatisierungen konnten wir jetzt die Personalkosten auf 28% senken.
Dann kam die Öffnungsklausel im Tarifvertrag für „notleidende“ Unternehmen, die es erlaubte, den Samstag als Regelarbeitstag einzuführen und jegliche Zuschläge für Samstagsarbeit abschaffte. Es gelang uns, eine scheinbare „Notsituation“ im Mutterwerk zu simulieren, indem Mittel in den Osten verlagert wurden und schon fielen auch die Zuschläge für Samstagsarbeit weg.
Bei jeder der Tariferhöhungen rechneten wir nun auch unsere übertarifliche Leistungen an, so daß bis etwa zum Jahr 2000 solche Leistungen zur extremen Ausnahme geworden waren. Wir zahlten nun puren Tarif. So schafften wir es, unseren Personalkostenanteil bis dahin auf etwa 25% der Gesamtkosten zu reduzieren. (...)
Die Gerüchte über anstehende Entlassungen wurden nun die Regel. Im Werk im Osten wurde geflüstert, es würden Produktionen ins Ausland verlegt, im Mutterhaus, sie würden in den Osten verlegt. Die Drohung, in den Osten umziehen zu müssen, wirkte fast so gut wie die Entlassungsdrohung. (...)
Nun wurden in beiden Werken regelmäßig Frühverrentungen durchgeführt. Allerdings waren nun die Bedingungen für die Frührentner deutlich ungünstiger. Nach der vorherigen Frühverrentungsaktion waren die Kandidaten schon deutlich vorgewarnt, denn eine große Zahl der Frührentner vom letzten Mal hatte gedacht, die gleichen Bedingungen wie die ersten zu bekommen, bekam sie aber nicht.
Jetzt waren alle sehr skeptisch und fanden bald heraus, daß die Zeit bis zur Verrentung mit einem geringen Zuschuß überbrückt werden mußte und zusätzlich auch noch mit 63 oder bei Frauen mit 58 in Rente gegangen werden mußte und damit ein deutlicher Abschlag an der Rente hinzunehmen war. Diesmal bekamen wir nicht genug Freiwillige zusammen, obwohl wir diesmal die Aktion für alle ab 56 geöffnet hatten. Wir mußten eine Zwangs-Frühverrentung durchführen, was eine Menge mehr Arbeit bedeutet.
Nach dieser neuen Verrentungsaktion gab es erste Schwierigkeiten an einigen Stellen in der Produktion und im Lager und Versand. Es fehlten erfahrene Kräfte, die schon fast jeden Typ von Problemen erlebt hatten und wußten, wie zu reagieren war. Die Verbliebenen hatten außerdem nicht mehr die absolute Identifizierung mit der Firma, wie sie früher unsere Belegschaft ausgezeichnet hatte. Wenn man unter der ständigen Drohung von Entlassung steht, hebt das nicht die Arbeitsmoral. Die nun deutlich verjüngte Belegschaft ließ einige Male voraussehbare Fehlleistungen oder Unfälle sehenden Auges geschehen, weil – wie einer sich ausdrückte – „sollen die doch den Karren an die Wand fahren“. (...)
Diesmal konnten wir von der Frühverrentungsaktion nur geringfügig mit verringerten Kosten profitieren, denn den verringerten Personalkosten standen Anstiege anderer Kosten gegenüber. (...)
Zwar wurden die Fehlzeiten deutlich verringert wegen der ständigen Angst vor Entlassung, aber gleichzeitig gingen Genauigkeit und Arbeitsgeschwindigkeit zurück.
Auch im Osten machten wir eine Frühverrentungsaktion, die dort besser angenommen wurde, so daß wir dort bei der Freiwilligkeit bleiben konnten. Auch war die Arbeitsmoral dort besser, so daß wir eine Anzahl neuer Produktionslinien dorthin legten. Damit waren aber im Mutterwerk erneut Maßnahmen zum Personalabbau angesagt. Wir offerierten für Freiwillige die Übersiedlung in den Osten, das nahmen aber nur 9 Arbeiter an. Damit mußte nun schon die vierte Frühverrentung angesetzt werden, zu erneut verschlechterten Bedingungen. Diesmal setzten wir das Mindestalter auf 50 Jahre und planten das Ganze von Anfang an als Zwangs-Frühverrentung.
Der Vorstand hatte diesmal nicht die Frühverrentung vorgeschlagen, sondern die Summe genannt, die an Personalkosten eingespart werden sollte. Wir hatten nun einen deutlich verjüngten Vorstand (der nun fast ohne Fachleute auskam und im wesentlichen von Juristen und Betriebswirtschaftlern gebildet wurde), der den einzelnen Werksbereichen nun jährlich Vorgaben gab, die bis Ende des Jahres erreicht werden mußten. Für uns in der Personalabteilung waren das nun Personalkostenverringerungen.
Ich hatte im Gespräch mit dem für mich zuständigen Vorstandsmitglied darauf hingewiesen, daß meine Vorgabe nur mit massiver Personalabbau umgesetzt werden könnte und dies voraussichtlich zu Engpässen in Produktion, Vertrieb, Lager und Auslieferung führen würde. Auch die Instandhaltung würde wohl über alle Maßen ausgedünnt – speziell, wenn der Abbau wieder über Frühverrentungen abgewickelt würde.
Er beschied mir aber kühl, ich solle mich nicht um Bereiche außerhalb meiner Verantwortung kümmern, das müsse ich dem Vorstand überlassen. Wenn eine weitere Frühverrentungsaktion nachteilig sei, dann könne ich ja eine „einfache“ betriebliche Entlassungsaktion ansetzen. Die Gespräche mit dem Betriebsratsvorsitzenden ergaben aber, daß er Entlassungen quer durch die Abteilungen anhand von durch die Abteilungsleiter zu erstellenden Listen, wie ich sie als Alternativkonzept vorgesehen hatte, für ihn nicht akzeptierbar waren.
Er sagte mir, daß wir dem Betriebsrat immer einen Spielraum für gewisse „Verbesserungen“ lassen müßten, sonst könne der Betriebsrat und die Gewerkschaft nicht mehr garantieren, daß die Arbeiter im Betrieb still hielten, die sowieso schon eine ziemliche Wut im Bauch hätten. Konkret hieß das, ich kündigte die Entlassungsaktion an, die in diesem Fall 10% der Belegschaft betreffen sollte – und der Betriebsrat würde dann in „zähen Verhandlungen“ mit mir das Schlimmste abwenden und die Aktion in eine Frühverrentung umwandeln können. So geschah es.
So wurden praktisch alle, die 50 und mehr Jahre alt waren, aus der Firma in die Frührente abgeschoben. Die Abteilungsleiter standen Schlange bei mir, um zu protestieren, aber ich verwies sie alle auf den Vorstand – der sie dann wieder an mich verwies. (...)
Für jenes Jahr wurde dann auch eine generelle Nichtübernahme verkündet. Die Ausbildungsplätze waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf 40% unseres früheren Standes zusammengestrichen worden. (...)
Tatsache war, daß nach dieser vierten und bei weitem größten Frühverrentungsaktion wirklich ernste Probleme in den schon genannten Bereichen auftraten.
Speziell die Instandhaltung war von der „Ausdünnung“ betroffen. Da die speziellen Probleme der Instandhaltung an keiner Hochschule gelehrt werden, waren hier die erfahrenen Mitarbeiter unersetzlich. Die Kenntnis von Hunderten von „Tricks“, die erfahrenen Instandhalter anwenden, waren mit den älteren Mitarbeitern verschwunden. Die Verbliebenen wußten zwar die Theorie, die Praxis ist aber weit vielfältiger. Das Ergebnis waren deutliche Anstiege an Ausfällen von Maschinen und Anlagen mit extrem kostenintensiven Ausfällen von Produktion und mit teuren und langandauernden Reparatureinsätzen, die von außerhalb zugekauft werden mußten.
Aber auch die Produktion als solche hatte nun Mängelrügen, Fehlchargen und andere kostspielige Ausfälle in einer weit höheren Anzahl als zuvor. Die vorher üblichen Maßnahmen, solche Ausfälle hereinzuarbeiten, klappten nicht mehr. Die Leistung der Arbeiter pro Stunde nahm ab statt zu. Andauernd standen Leute ohne Arbeit in den Hallen herum, weil technische Mängel aufgetreten waren. Die Meister, die vorher geschworen hatten, sie hätten alles im Griff, mußten nun zugeben, daß die erfahrenen Mitarbeiter, die oft wußten, was zu tun war, nicht so ohne weiteres ersetzt werden können. Viele Probleme hatten die Arbeiter und Vorarbeiter vorher selbst gelöst, ohne daß der Meister auch nur davon erfuhr. Nun waren die entscheidenden älteren und erfahrenen Vorarbeiter nicht mehr da.
Ähnliches galt für den Vertrieb, das Lager und die Auslieferung. Als die Abteilungsleiter merkten, daß sie plötzlich deutlich angestiegene Kosten in ihren Abteilungen hatten, versuchten sie, mit der Einführung striktester Regeln und ständigen Überwachungen dagegen vorzugehen. Aber das war die „falsche Medizin“. Es handelte sich nicht um die Folge von Undiszipliniertheiten, sondern um mangelnde Erfahrung. Nun fühlten sich die Verbliebenen auch zusätzlich noch nicht genügend respektiert, was erneut die Arbeitsmoral verschlechterte. Der vorher schon erwähnte Effekt des „laß sie es doch an die Wand fahren“ wurde so noch verstärkt und die Kosten stiegen noch mehr.
Das Jahr 1998 war dann ein gespanntes Jahr mit andauernden Krisensitzungen. Die Kosten waren höher als bei der Konkurrenz, das machte sich bemerkbar : Der Absatz stagnierte. Der Vorstand versuchte verzweifelt herauszufinden, was eigentlich die gestiegenen Kosten verursacht, war aber dabei auf der Suche nach Sündenböcken und nicht den wirklichen Ursachen. Ich wies mehrmals in solchen Sitzungen darauf hin, was wirklich vorgefallen war, aber der Vorstand wollte das nicht wahrhaben, denn damit hätte er seine eigene Verantwortung zugestanden.
Im Jahr 1999 zischelte mir sogar einer der Vorstände einmal zu, ich solle mich in Acht nehmen mit solchen Vorwürfen. Wie zu erwarten, wurde mir für Ende des Jahrtausends eine Frühverrentung verpaßt, angeblich zum 60. Geburtstag, aber ich wurde erst im Jahre 2000 Sechzig.
Noch im Jahre 99, ich hatte bereits eine schöne Übergangszahlung für die fünfeinhalb Jahre bis zur Rente im Vertrag, wechselte der Besitzer der Firma. (...)
Offenbar war es nicht verborgen geblieben, daß die Firma mit höheren Kosten als die Konkurrenz arbeitete und jemand glaubte, mit seinen Patentrezepten die Firma wieder auf Kurs bringen zu können und dann mit Gewinn wieder zu verscherbeln.
Es wurde in gigantischem Ausmaß in Automation und Computerisierung investiert, allerdings alles auf Pump. Ich bezweifelte damals schon, ob das der Ausweg wäre, aber es interessierte mich in Wirklichkeit schon gar nicht mehr.
Tatsache war, daß die Kosten nun erneut angestiegen waren durch die Zins- und Tilgungskosten der Finanzierung. (...)
Zwei Jahre nach meinem Ausscheiden wurde die Firma als Sanierungskandidat erneut verkauft. Inzwischen hatte es schon massive Entlassungen gegeben. (...)
Heute liegt die Firma in den letzten Zügen. Sie hat nur noch ein Drittel der Belegschaft. Voraussichtlich noch dieses Jahr wird ein Vergleichsverfahren erwartet – ob das noch etwas retten kann, ist zweifelhaft.
Ich hoffe, es wurde nicht auch die Kasse der Zusatzrente geplündert. Wenn ich mit meiner Rente auskommen müßte......“